 An dieses Stadttor aus dem 14. Jh., das auch „Grubener Tor“ oder im Polnischen „Törchen“ genannt wurde, wurde um das Jahr 1620 eine der Leidenden Mutter Gottes gewidmete Kapelle in Stile der niederländischen Renaissance angebaut. An der Ostwand befindet sich in einer Nische eine Pieta, im Inneren der Kapelle hingegen ein barocker Messtisch. Eine Pieta aus dem 15. Jh. steht auf dem Altar. Ebenso befindet sich in der Kapelle eine Skulptur, die den bekümmerten Christus darstellt. Weiter gibt es ein Ölgemälde aus dem Jahre 1762, das den hl. Jan Kant mit der Stadtansicht von Culm im Hintergrund darstellt.
An dieses Stadttor aus dem 14. Jh., das auch „Grubener Tor“ oder im Polnischen „Törchen“ genannt wurde, wurde um das Jahr 1620 eine der Leidenden Mutter Gottes gewidmete Kapelle in Stile der niederländischen Renaissance angebaut. An der Ostwand befindet sich in einer Nische eine Pieta, im Inneren der Kapelle hingegen ein barocker Messtisch. Eine Pieta aus dem 15. Jh. steht auf dem Altar. Ebenso befindet sich in der Kapelle eine Skulptur, die den bekümmerten Christus darstellt. Weiter gibt es ein Ölgemälde aus dem Jahre 1762, das den hl. Jan Kant mit der Stadtansicht von Culm im Hintergrund darstellt.
Weitere Informationen über das Graudenzer Tor sowie die anderen einstigen Stadttore mit Fotos finden Sie auf der Website moje-chelmno.pl.
Seit 2007 ist an der östlichen Seite des Graudenzer Tors eine Gedenktafel für Papst Johannes Paul II. angebracht. In unmittelbarer Nähe befinden sich das Gebäude Grudziądzka 36, die Neue Promenade sowie die Gnadenkapelle.
Nach im Februar 2024 veröffentlichten Informationen der Stadtverwaltung Chełmno sollen in absehbarer Zeit umfassende Restaurierungsarbeiten am Graudenzer Tor vorgenommen werden. Entsprechende Planungsunterlagen sind bereits erstellt worden. Das mittelalterliche Stadttor soll durch diese Maßnahmen auch zu einer Art Kunstgalerie umgestaltet und so ausgestattet werden, dass sowohl in der Tordurchfahrt als auch in der Kapelle im Obergeschoss Wechselausstellungen möglich sind. Für das gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde St. Marien durchgeführte Projekt sollen EU-Fördergelder beantragt werden.

Graudenzer Tor / Brama Grudziądzka (08.02.2024)
[Erstveröffentlichung dieses Beitrags: 08.12.2007; ergänzt 19.06.2012, 08.02.2024]













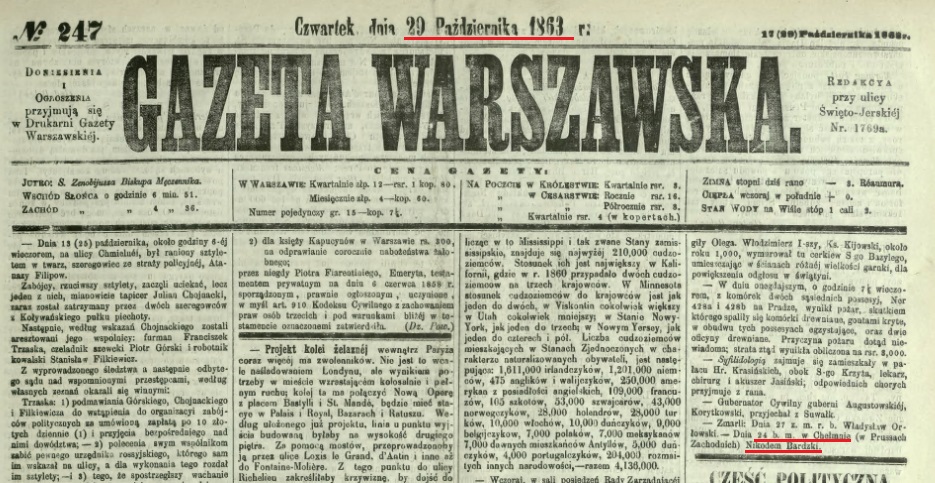






















 Die Dominikanerkirche (St. Peter und Paul) im nordöstlichen Teil der Altstadt an der Ulica Wodna und Ulica Kościelna bildet ein häufiges Ziel deutscher Touristen, die auf den Spuren ihrer Kindheit oder Vorfahren nach Chełmno (Culm) kommen. Vom 1. August 1841 bis zum 21. Januar 1945, als Gerhard Tietze, der letzte protestantische Pastor in Culm, vor seiner Flucht nach Westen noch einen Gottesdienst hielt, diente sie nämlich der evangelischen Gemeinde als Gotteshaus.
Die Dominikanerkirche (St. Peter und Paul) im nordöstlichen Teil der Altstadt an der Ulica Wodna und Ulica Kościelna bildet ein häufiges Ziel deutscher Touristen, die auf den Spuren ihrer Kindheit oder Vorfahren nach Chełmno (Culm) kommen. Vom 1. August 1841 bis zum 21. Januar 1945, als Gerhard Tietze, der letzte protestantische Pastor in Culm, vor seiner Flucht nach Westen noch einen Gottesdienst hielt, diente sie nämlich der evangelischen Gemeinde als Gotteshaus.
 Weitere Informationen über die Dominikanerkirche mit vielen Fotos finden Sie auf der Website
Weitere Informationen über die Dominikanerkirche mit vielen Fotos finden Sie auf der Website 













